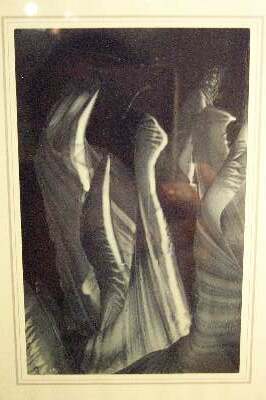Politik im engeren Sinn kümmert sich um die Interessen der an einem Prozess beteiligten und deren Ausgleich. Dazu müssen die von einer Entscheidung betroffenen tunlichst eine Vertretung haben. Auch muss es für den Einigungsprozess und das Handeln der Prozessbeteiligten Verhaltensnormen geben, damit der Prozess funktionieren kann. Eigentlich selbstverständlich – Moral ist für den Prozess unverzichtbar. Ich benutze lieber den Begriff Moral, um konkrete Werte zu markieren als Ethik, der ich einen allgemeinen Sinn vorbehalte. Eine zweite Ebene betrifft die Moral der Entscheidungen. So können selbstverständlich moralische Maximen das Interesse der Prozessbeteiligten ausmachen oder modifizieren. Auch damit erscheint klar, dass auch eine inhaltliche moralgetriebene Politik durchaus möglich und vertretbar ist. Ist sie aber auch notwendig? Und ist hier zwischen einer persönlichen Moral und einer politischen Moral zu unterscheiden?
Autor: Martin Landvoigt
Das Böse und der zweite Hauptsatz der Thermodynamik
Das Böse wurde zuweilen in Form des Satans, als Person und treibende Kraft verstanden. Andere Generationen und Denker nannten es als die Abwesenheit des Guten (Plotin, Augustinus und Thomas von Aquin). Manche bezweifeln, dass es sinnvoll sei, von dem Bösen überhaupt zu sprechen. Es ist eine Frage des Selbstverständnisses, ob man sich selbst im Spannungsfeld zwischen Gut und Böse versteht, oder – mangels der Existenz des Bösen – eben keine Polarisierung zwischen richtig und falsch annimmt. Die dualistische Weltsicht vs. die monistische Weltsicht. Hier will ich als These des Bösen als Herleitung aus der Naturbetrachtung ziehen. „Das Böse und der zweite Hauptsatz der Thermodynamik“ weiterlesen
Rassismus und Prioritäten
Ein angstbesetztes und stigmatisierndes Wort. Wer als Rassist gebrandmarkt wird ist schnell weiter im gesellschaftlichen Aus als zu manchen Zeiten Mitglieder geschmähter ‚Rassen‘. Ohne Zweifel ist es moralisch inakzeptabel, Menschen nach äußeren Merkmalen oder Assoziationen mit Dritten oder einem Stereotyp zu beurteilen. Die Zugehörigkeit zu einer Ethnie oder sonst wie identifizierbaren Gruppe erlaubt noch kein Urteil über einzelne Personen. Aber was ist das nun genau, dass im gesellschaftlichen Diskurs zur Stigmatisierung führt? Hat das mt Prioritäten und Werten zu tun?
Warum ist der Kulturrelativsmus falsch?
Kulturrelativsmus ist in Deutschland zur Zeit in Mode und gilt als politisch korrekt. Ist es nicht gerade moralisch, die Anderen in ihrer jeweiligen Kultur grundsätzlich als gleichwertig zu erachten, und fremdenfeindlich und chauvinistisch, das nicht zu tun? Ich halte das für grundfalsch und unmoralisch, denn damit wird der Beliebigkeit und Morallosigkeit Tür und Tor geöffnet. Das aber ist näher zu begründen:
Kulturbetrachtungen in Wehmut
Ein Konzert der Barockmusik, Telemann, Vivaldi und Bach, vorgetragen von meist jungen Musikern der Musikhochschule, lieferte ein außergewöhnliches Erlebnis. Die Zuschauer sahen Menschen, die sich nach jahrelangen und intensiven Studium zu Virtuosen auf ihren Instrumenten entwickelt haben. Alles atmete Konzentration. Sicher ging es auch ein wenig um die Konventionen des Kulturbetriebs, um den guten Ton, aber das liefert nur die Leinwand, auf der sich eine wertvolle Substanz offenbarte: Hingabe, Komplexität, Harmonie. Doch was bedeutet das?
Kosten/Nutzen-Betrachtungen in der Ethik
Der Gegensatz provoziert. Ein Kosten/Nutzen-Ansatz ist Kern ökonomischen Denkens. Dieses ist stets begleitet von dem Verdacht des unmoralischen Egoismus, der gerade der Kontrapunkt der Ethik ist. Aber ist es moralisch denn vertretbar, nicht nach Kosten/Nutzen-Analysen zu handeln?
Sicher ist ein spontanes Handeln in einer konkreten kurzfristige Situation ein Gebot der Stunde, welches langwiergem Abwägen widerspricht. Aber oftmals ist durchaus die Zeit gegeben, wohlüberlegt in moralischer Reflektion zu handeln. Nichts anderes ist die Frage nach der Verantwortung.
Ethische Aspekte der Migrationspolitik
Der Hebel, mit dem Deutschland sich hinsichtlich der Bevölkerungszusammensetzung immer mehr verändert, hieß einst Gastarbeiter, nun Asyl und Flüchtlingshilfe. Diese wird immer mehr von einem ethischen Duktus – in der Ausprägung der Gesinnungsethik – befeuert. Doch zuerst zur Vorgeschichte:
Andreas Körber zur Debatte um „Deutsche Kultur“ – Eine Replik
Mit Das Unbehagen mit Volk und Leitkultur habe ich bereits eine Bestimmung zu dem kontroversen Thema geliefert. Quentin Quencher hat auf Glitzerwasser ebenfalls einige Gedanken veröffentlicht: Ein neues Sinnbild für Deutschland.
Zum Thema hat Andreas Körber (AK) hat auf L.I.S.A. Wissenschaftsportal der Gerda-Henkel-Stiftung neben mehreren anderen empfehlenswerten Beiträgen, im Besonderen von
einen Beitrag geliefert, der m.E. einer Diskussion bedarf. Unglücklicherweise sind oft die hervorragenden Beiträge, zu denen man kaum mehr als applaudieren kann, weniger der Anlass der Auseinandersetzung als jene, die eben nicht auf Zustimmung stoßen. Somit dienen gerade die fragwürdigen Darstellung der Schärfung der eigenen Gedanken:
„Andreas Körber zur Debatte um „Deutsche Kultur“ – Eine Replik“ weiterlesen
Kränkungen der Menschheit
Sigmund Freud behauptete, dass die Wissenschaften geeignet sind, den Menschen narzistische Kränkungen zuzufügen.
In seiner Arbeit „Eine Schwierigkeit der Psychoanalyse“ aus dem Jahre 1917 stellt Freud die Widerstände dar, die der von ihm entwickelten Psychoanalyse seiner Auffassung nach entgegenstehen, bevor sie allgemein anerkannt werde. Wie jede wissenschaftliche Neuerung müsse sie sich gegen das etablierte Denken durchsetzen. Aber der „größere Anteil rührt davon her, daß durch den Inhalt der Lehre starke Gefühle der Menschheit verletzt worden sind.“
Hmmm … allerdings kann man auch vermuten, dass Freud begründete Kritik als emotional bedingt zu denunzieren versucht. Es ist darum genauer zu prüfen, wie stichhaltig seine Argumente sind, mit der er seine These begründet. Denn es erscheint zwar einsichtig, dass es emotionale Gründe zu einer Ablehnung einer missliebigen Theorie geben kann, aber daraus folgt nicht, dass jede Ablehnung einer These auch emotionale Gründe haben muss. Im Besonderen wurde die These Freuds als ein generelles Deutungsschema vielfältig und unkritisch zitiert, unter Anderem bei Richard Dawkins in ‚Der Gotteswahn‘. „Kränkungen der Menschheit“ weiterlesen
Betrachtungen zur Meinungsbildung
Manche haben zu allem eine Meinung, manche zu sehr wenigem. Wo kommt die Meinung eigentlich her? Oft werden Meinungen tradiert über Kultur, Familie, Schule und Peer-Group. Das rationale Ideal sieht den Prozess der Meinungsbildung so:
- Der Mensch wird sich gewahr, dass ihm die Bedeutung eines Sachverhaltes nicht klar ist, er aber dazu Kenntnisse und Meinung erwerben will.
- Er macht sich möglichst umfassend sachkundig und studiert Quellen kritisch.
- Aus dem Gelernten bildet er sich ein Urteil: Seine Meinung.
Dieser einfache Prozess funktioniert oft nicht.