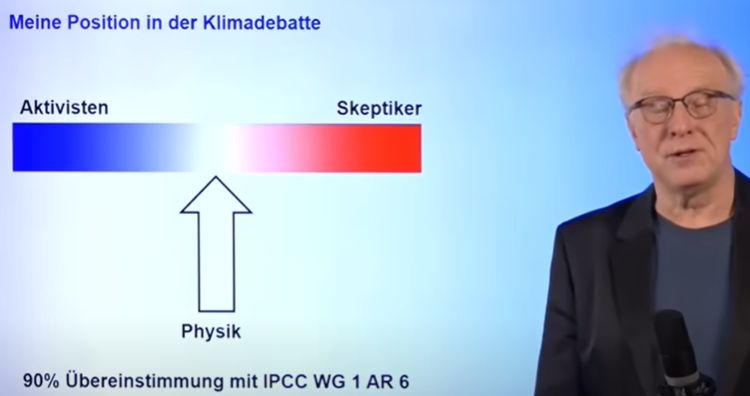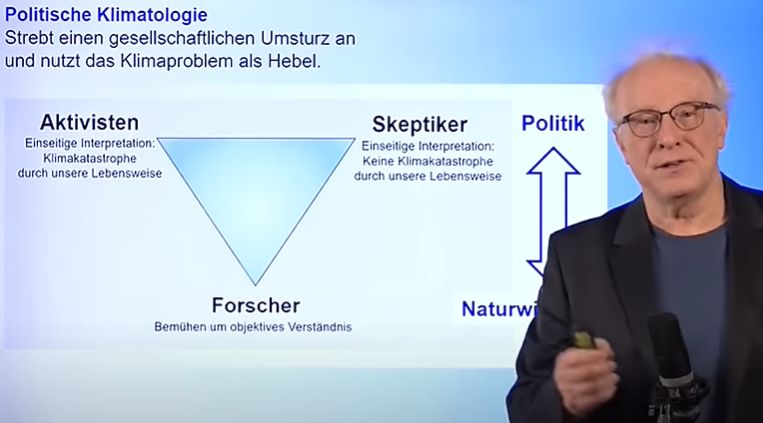Predigtentwurf. Anmerkung: Eine Predigt hat die Aufgabe, die Gegenwart Gottes nicht nur jenen zu vermitteln, die bereits ihr Vertrauen auf Gott gesetzt haben, sondern auch jenen, die Gott nicht kennen oder seine Existenz bestreiten.
Im Neuen Testament spricht Johannes:
Wer nicht liebt, der kennt Gott nicht; denn Gott ist Liebe.
1. Johannesbrief 4,8
Diese Diktion irritiert, denn Liebe wird zuweilen als Gefühl oder Lebenseinstellung verstanden, wohl kaum aber personal. Allerdings kann Liebe nicht unabhängig von Gott gedacht werden, denn woher sollte die Liebe kommen, wenn sich nicht aus Gott wäre. Könnte Gott schlicht die Liebe erfunden haben, so wie er alles geschaffen hat? Dann hätte es einen Zustand gegeben, in dem Gott noch ohne Liebe war … auch nicht recht vorstellbar. Also können wir den Satz des Johannes durch reines Nachdenken bestätigen: Die Liebe ist das Wesen Gottes. Aber das führt zu weiteren Herausforderungen der Vorstellung …
„… und hätte der Liebe nicht …“ weiterlesen