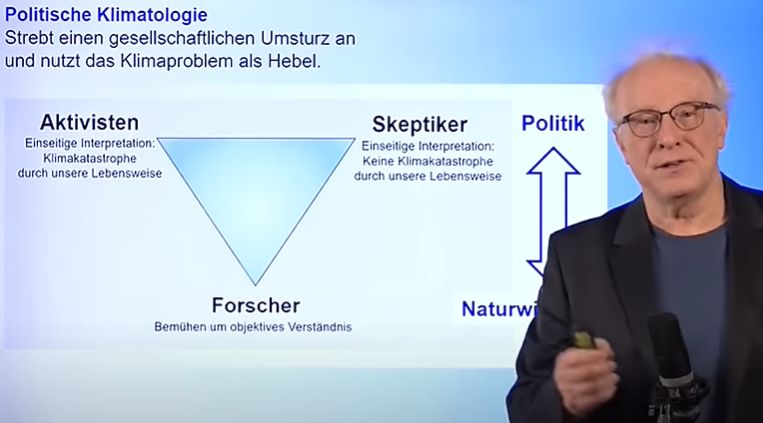Ein Predigtentwurf – Schriftlesung: 1.Korinther 1,19 : Denn es steht geschrieben: »Ich will zunichtemachen die Weisheit der Weisen, und den Verstand der Verständigen will ich verwerfen.« 20 Wo sind die Klugen? Wo sind die Schriftgelehrten? Wo sind die Weisen dieser Welt? Hat nicht Gott die Weisheit der Welt zur Torheit gemacht? 21 Denn weil die Welt durch ihre Weisheit Gott in seiner Weisheit nicht erkannte, gefiel es Gott wohl, durch die Torheit der Predigt selig zu machen, die da glauben.
Eine herbe Brise verweht die Hitze des Tages. Moses Blick ruht auf den Bergen am Horizont, die Ziegen suchen sich die Grashalme zwischen den Steinen. Frieden. Zwischen den Felsen eilt Schlomo aufgeregt zu Mose:
‚Ich hatte eine Offenbarung. Jetzt weiß ich, wie Gott die Welt erschuf!‘ Triumphierend konnte er nicht auf die Rückfrage seines Freundes warten:
‚Das war nämlich so: Vor 13,81 Milliarden Jahre schuf Gott eine Quantenfluktuation und der Urknall bildete das Universum. Das expandierte rasch. …‘
„Schöpfungsgeschichte, Version 2“ weiterlesen